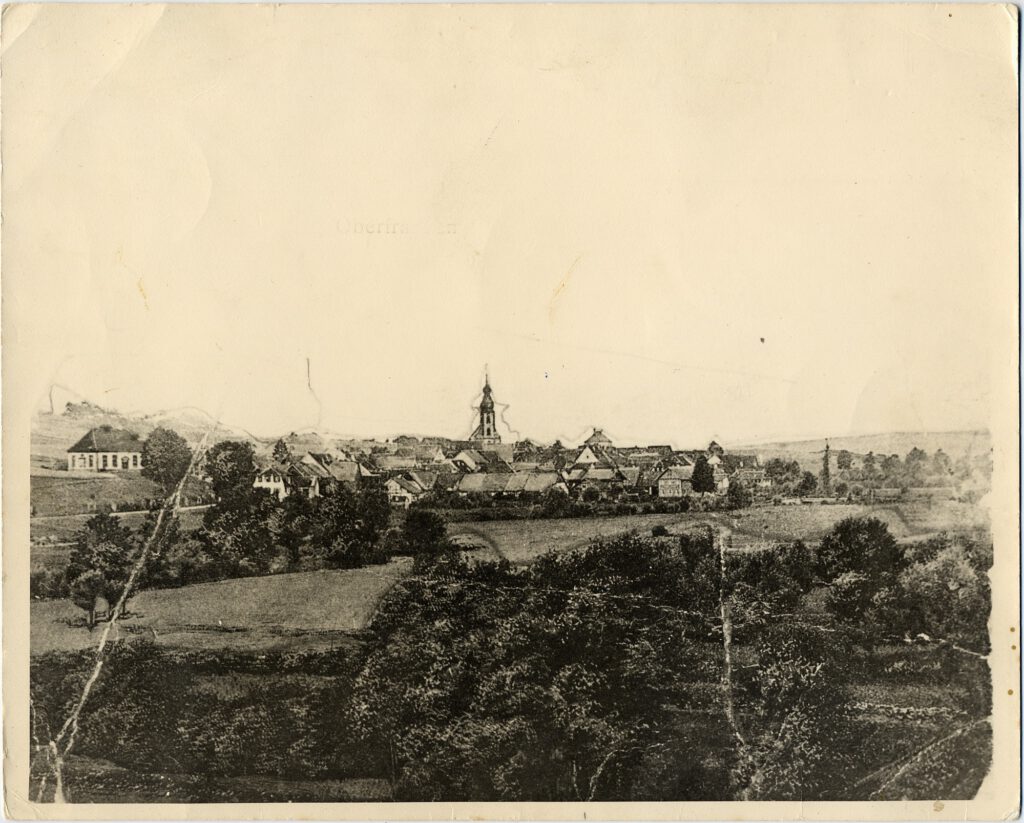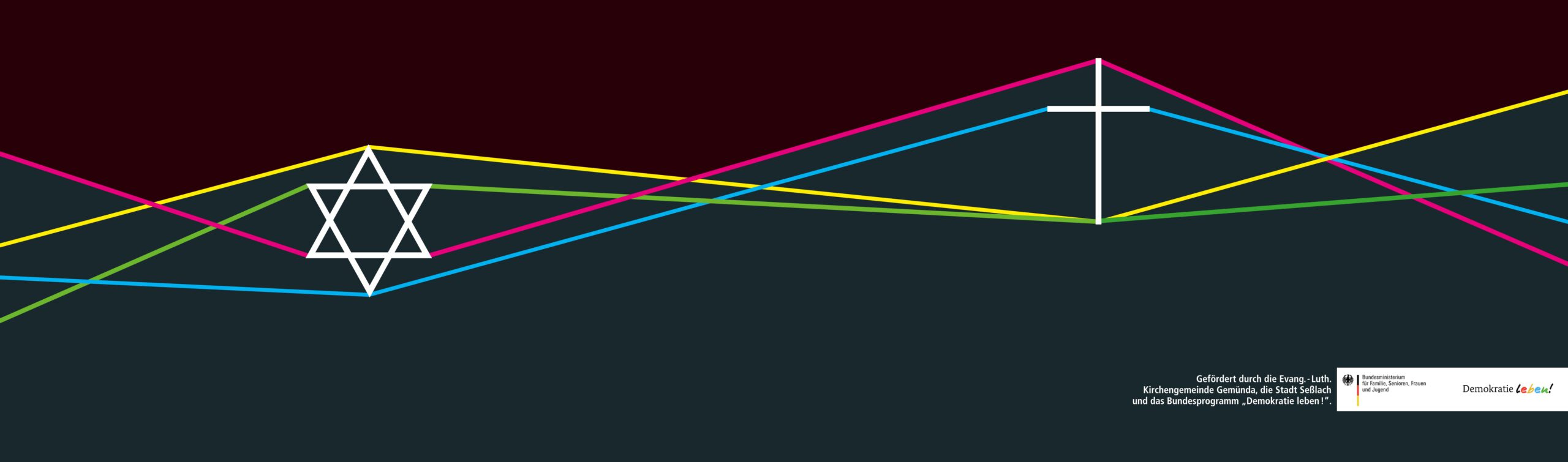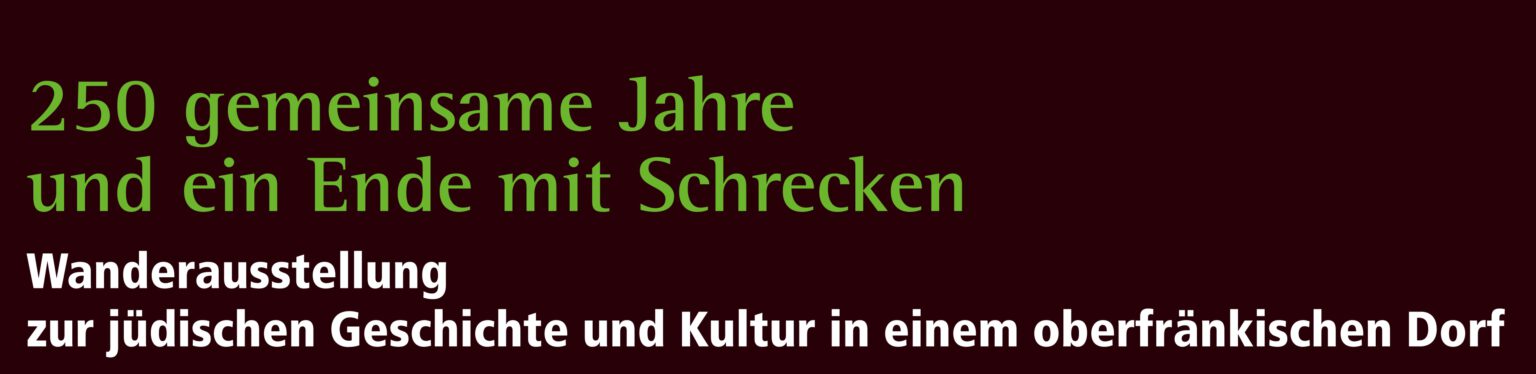
Die Ausstellung basiert auf den Recherchen von Manuel Gruber, Andreas Gsänger, Dr. Hubertus Habel und Gaby Schuller. Gestaltet hat sie Josef Starkl.
Sie wurde erstmals am 02. 11. 2023 in Autenhausen gezeigt, anlässlich des 100sten Jahrestages des dortigen Pogroms.
Die Arbeitsgruppe und die Stadt Seßlach danken den Förderern für ihre Unterstützung.
Gefördert durch die Evang. – Luth. Kirchengemeinde Gemünda, die Stadt Seßlach und das Bundesprogramm „Demokratie leben !“.
Lange Zeit war die Geschichte der Juden in Autenhausen wenig beachtet und blieb überraschend unerforscht. 2023 hat sich eine Arbeitsgruppe mit interessierten Akteuren gebildet, und in Zusammenarbeit mit der Stadt Seßlach das Projekt „JA – Jüdisches Autenhausen“ begonnen. Ihr Ziel: das örtliche jüdische Leben und die Menschen wieder sichtbar zu machen.
Dazu gehört diese Wanderausstellung, die die Grundzüge der jüdischen Kultur und Geschichte Autenhausens vermittelt.